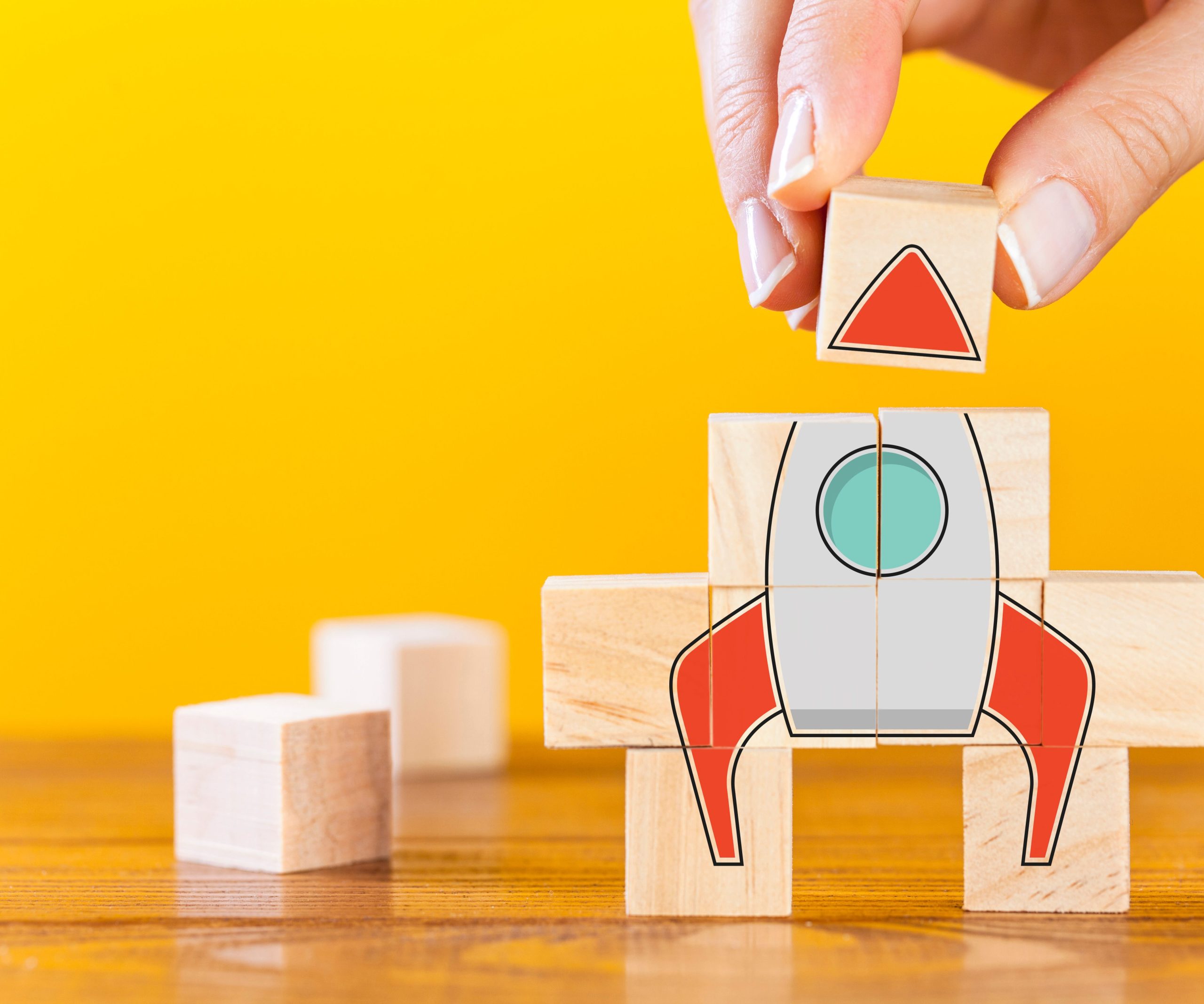Selbstständigkeit durch Praxiskauf
[Abo] Ein Haus zu kaufen ist wohl leichter als eine Praxis zu erwerben. Im Vorfeld ist viel zu berücksichtigen. Welche Punkte beachtet werden müssen, damit Käufer und Verkäufer „zusammenkommen“, erläutert Josef Förster in diesem Beitrag.

Naht für eine Praxisinhaberin das Ende der beruflichen Tätigkeit ist oftmals der Gedanke an einen Praxisverkauf naheliegend. Andererseits beziehen Podologinnen, die sich selbstständig machen wollen, einen Kauf – neben der Praxisgründung – in ihre Planungen ein. Motiv ist bei den Verkäuferinnen die Absicht, einen gewissen Betrag für die eigene Altersabsicherung zu erlösen, bei den Käuferinnen der Wunsch, den mühsamen Aufbau einer eigenen Praxis zu vermeiden. Bei den Verkäuferinnen spielt oftmals auch eine Rolle, die über viele Jahre versorgten Patientinnen und Patienten in „gute Hände“ weiterzugeben (wobei natürlich klar ist, dass der Kundenstamm nicht verkauft werden kann und darf).