Betrachtungen zur Metatarsalgie
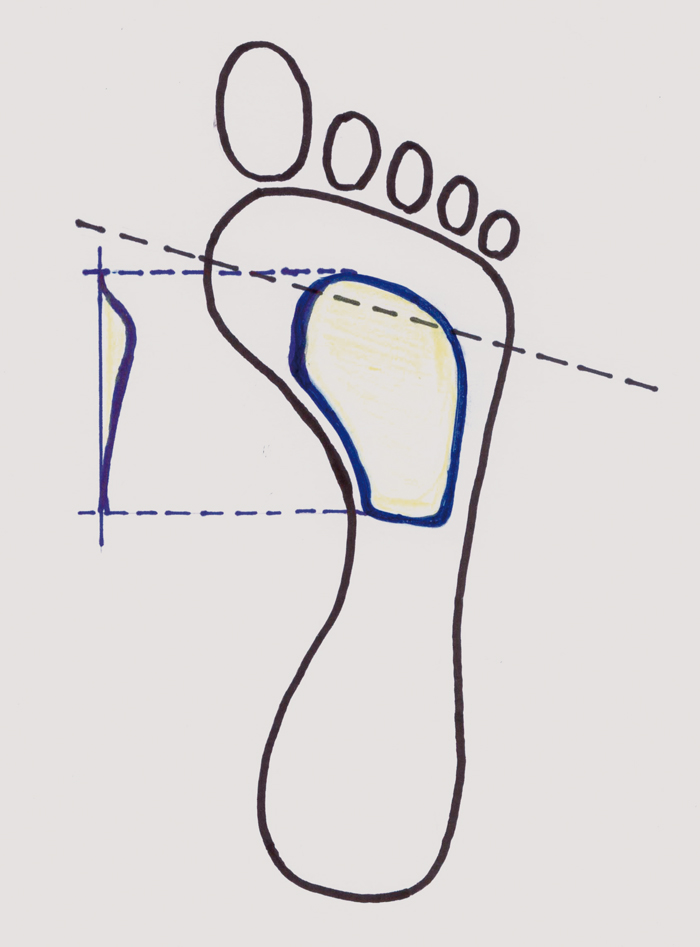
Zu möglichen Differenzialdiagnosen zählen die Morton Neuralgie, eine Entzündung der Gelenkkapsel (Metatarsitis), die Bursitis, ein Riss der Plantaraponeurose im Bereich der Mittelfußköpfchen, Stressfrakturen, eine Atrophie des Fettgewebes (unter den Mittelfußköpfchen), die Köhler-II-Erkrankung (aseptische Knochennekrose), die rheumatoide Arthritis, die Sesamoiditis (Entzündung eines oder beider Sesambeine unter dem Kopf des Metatarsale1) sowie Verhornungen (Clavi, Callositas).
Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.
Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.





