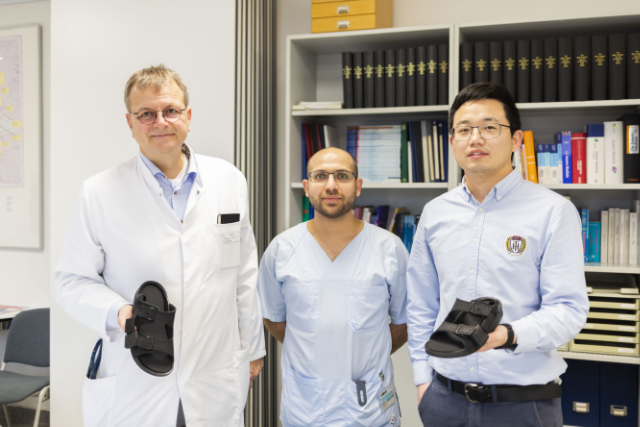Neurinome am Fuß

Daher ist „Schwannom“ die pathophysiologisch korrekte Bezeichnung für ein Neurinom. Weitere Synonyme sind „Neurilemmon“, „Benigner peripherer Nervenscheidentumor (BPNST)“ oder „Schwann-Zell-Tumor“. Langsam wachsende Neurinome gehen von den Schwann-Zellen aus. Sie befinden sich in den umhüllenden Markscheiden des peripheren Nervs, deren Fortsätze sie umschließen. Sie haben die Aufgabe die Leitgeschwindigkeit des Nervs zu erhöhen. Eine maligne Entartung peripherer Nervenscheidentumoren (MPNST) ist relativ selten. Nach Literaturangaben beträgt die Malignität zirka ein Prozent.
Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.
Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.