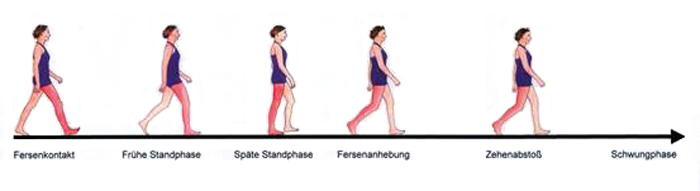Teilaspekte einer Fußuntersuchung

Der in der Praxis ermittelte allgemeine Fußstatus (die Befunderstellung vor der Fußbehandlung) lässt nach seiner Auswertung die Behandlungsrisiken des Patienten erkennen. Nach der Erstuntersuchung wird in der Folge über den möglichen Behandlungsverlauf, die Behandlungsmaßnahme und Behandlungsaussicht entschieden. Die Fehlbelastung des Fußes mit ihren Auswirkungen (Schmerzen, Hyperkeratosen etc.) wird dokumentiert und eventuell eine Entlastungsmaßnahme vorgesehen. Die sensorgesteuerten Druckmessplatten können vor einer möglichen Ulcus-Entstehung am Fuß warnen, wenn bestimmte Belastungswerte überschritten werden. Messbar ist hier allerdings nur die Auswirkung auf das letzte Glied einer fehlerhaften Belastungskette. Der eigentliche Ursprung liegt weiter oberhalb – in dem eingeschränkten Zusammenspiel von Muskeln, Bändern und Gelenken des Bewegungsapparates.
Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte.
Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.